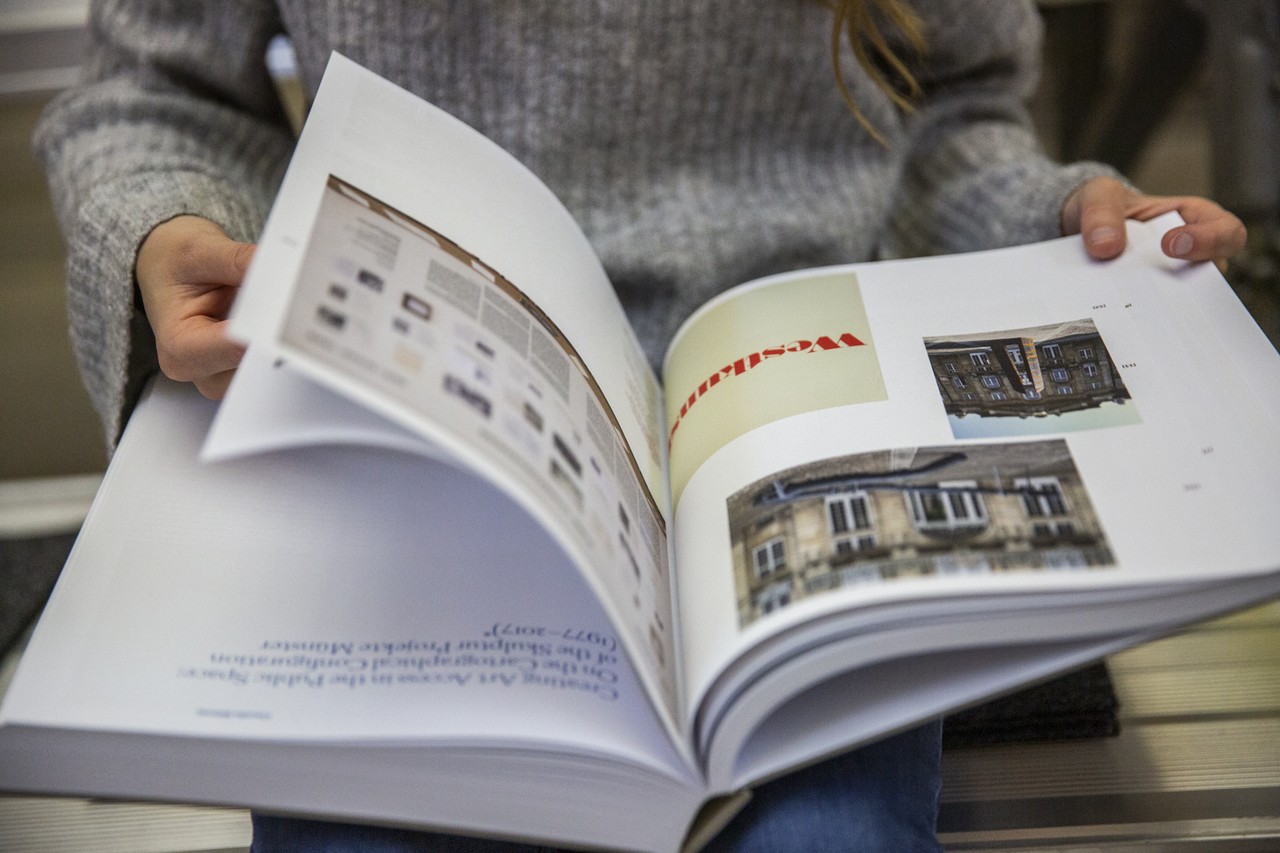Von Sara Hirschmüller (stud. Volontärin Kunstvermittlung)
Öffentlichkeit und Teilhabe sind Grundlagen jeder Demokratie und einer offenen Gesellschaft. Sie bestimmen die Positionierung und Entwicklung eines ungewöhnlichen Ausstellungsformats: der Skulptur Projekte in Münster. Die Publikation „Public Matters“ bündelt die Ergebnisse einer dreijährigen Forschungskooperation zwischen dem LWL-Museum für Kunst und Kultur und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zum Skulptur Projekte Archiv. Doch wie hängen die Publikation, das Forschungsprojekt, die Ausstellung und das Forum zusammen? Im Gespräch über die Aktivitäten rund um das Skulptur Projekte Archiv mit Prof. Dr. Ursula Frohne (WWU) und Dr. Marianne Wagner (LWL-MKK) gehen wir der Frage auf den Grund.
Wer steckt hinter dem Skulptur Projekte Archiv?
Marianne Wagner: Das ist eigentlich eine lustige Frage, weil wir uns immer fragen: Was steckt IM Archiv. Aber wenn es darum geht, wo es angesiedelt ist, könnte man es so beantworten, dass das Skulptur Projekte Archiv zur Sammlung Gegenwart des Museums gehört. Dass das Archiv Teil der Sammlung ist, zeigt sich auch an den Aktivitäten. Zum Beispiel ist Ludger Gerdes’ Schiff für Münster im Rahmen der Ausstellung Hans Blumenberg. Denken in Metaphern im Sammlungsbereich ausgestellt, sonst sind Objekte des Archivs häufig auch in wechselnden Präsentationen im Lichthof zu sehen. Das zeigt, wie wichtig die Museumsstruktur ist: dahinter stehen auch die Abteilung Dokumentation, Handwerker:innen und Mitarbeiter:innen im Depot. An einem Haus wie unserem sind viele Abteilungen beteiligt und nicht nur eine, die das Archiv verantwortet.
Wer legte den Grundstein für das Skulptur Projekte Archiv?
MW: Historisch betrachtet gab es in der Vergangenheit einige Anläufe, das Skulptur Projekte Archiv zu verstetigen und zu einer Einrichtung für die Öffentlichkeit und die Forschung zu machen. Der frühere Museumsdirektor und Begründer der Skulptur Projekte, Klaus Bußmann, hat in den 1980er Jahren bereits in Publikationen und Interviews vom Skulptur Projekte Archiv gesprochen. Brigitte Franzen hat mit einer großen Archiv-Ausstellung zu den Skulptur Projekten 2007 und einem Vorstoß beim Getty Institute ebenfalls an der Institutionalisierung gearbeitet. Das Sammeln fing jedoch schon viel früher an, nämlich vor den ersten Skulptur Projekten. Klaus Bussmann, und später auch Kasper König, hatte die Weitsicht, Akten im Museumsdepot aufzubewahren. Das legte die Basis für ein Entstehen des Archivs. Dieser Vorlauf sowie fünf Editionen, also 40 Jahre Skulptur Projekte sowie eine Kooperationspartnerschaft mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster machten es möglich, 2017 dann endlich mit einem Forschungsprojekt die Bestände des Archivs zugänglich zu machen. Gemeinsam mit der Universität reichte das Museum einen großen Forschungsantrag bei der VolkswagenStiftung ein. Damit haben wir nicht nur eine Aufarbeitung der Archivalien in Gang gesetzt, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, an der Universität Forschungsarbeiten entstehen zu lassen und das Archiv in die Lehre einzubringen.
Ursula Frohne: Die Förderlinie der Stiftung – Forschung in Museen – war für uns sehr passgenau. Die VolkswagenStiftung hat vor zehn Jahren hiermit ein einzigartiges Förderprogramm aufgelegt, das dazu dienen soll, genau das, was in Museen heutzutage leider zu kurz kommt, nämlich Forschung, mit Vermittlung zu verbinden und zu fördern. Es wurde dem Museum somit ein Instrument an die Hand gegeben, mit dem es auch intern wieder Forschung leisten kann. Die Voraussetzung für diese Förderung ist tatsächlich die Kooperation mit einer Universität, die wissenschaftliches Arbeiten gewährleistet. In diesem Zusammenhang haben wir unseren Antrag erarbeitet und konnten das Archiv als eine Einheit darstellen, was sich auch in der Publikation wiederfindet und über die Digitalisate im Netz sichtbar wird. In der Publikation „Public Matters“ wird das Archiv auch als eine Ressource sichtbar, die eine Vielfalt von lohnenswerten Forschungsfragen aufwirft.
Welches Potenzial bietet das Archiv?
UF: Das Archiv bietet die Möglichkeit, verschiedene Diskurse, beispielsweise Fragen zu Kunst im Öffentlichen Raum, zu einzelnen Künstler:innen oder zu konservatorischen Aspekten, zu führen. Und das Material wirft auch selbst Fragen auf: Was ist Öffentlichkeit? Welchen Beitrag kann die Kunst leisten? Das sind Fragen, die aus dem Archiv heraus generiert wurden. Diese wiederum sind in verschiedene wissenschaftliche Arbeiten hineingeflossen, in Gespräche und Vorträge oder auch in die Ausstellungskonzeptionen, die aus dem Archivmaterial im Zuge dieser drei Jahre entstanden sind.
Wie kam es zu der Publikation Public Matters?
MW: Häufig sind es Publikationen, in denen Forschungsergebnisse sichtbar werden. In unserem Fall versteht sich das Buch selbst als eine Form des Archivs und damit auch als einen fortlaufenden Prozess. Eingeflossen in die Debatten der Publikation sind auch vielschichtige Outputs. Die Blumenberg Lectures, die während der Skulptur Projekte 2017 unter dem Titel Metaphern des Gemeinsinns – Contesting Common Ground stattfanden, oder auch die große Ringvorlesung [Counter-]Monuments. Erinnerungspraxen im öffentlichen Raum waren wichtige Debattierplattformen, deren Austausch und Themen das Buch prägten. In den drei Forschungsjahren veranstalteten wir immer wieder Workshops und Veranstaltungen auch zu verschiedenen Themen. All das fließt auch in die Publikation ein. Dieser Austausch ist aber nochmals eine andere Form, in der Dinge sichtbar werden, die wir im Archiv bearbeiten. Deshalb ist der ganze Forschungsprozess wichtig.
UF: Ein Grundgedanke für unsere Annäherung an das Archiv war unter anderem die Frage nach der Relevanz des Archivs für die Öffentlichkeit. Das Archiv schien uns nicht nur als eine Ressource für den Zugang zur Vergangenheit wichtig, sondern es muss als etwas gesehen werden, das auch für unsere Gegenwart von essenzieller Bedeutung ist – für den kulturellen Standort Münster, für die Ausstellungsgeschichte, die künstlerischen Konzeptionen und wie diese in die Zukunft wirken können. Uns war natürlich klar, dass der Output eine Publikation sein musste. Einerseits für die Forschung, andererseits um das Archiv dokumentiert zu wissen.
Wie sind die Publikation, das Forum und die Ausstellung The Public Matters miteinander verknüpft?
UF: Marianne hatte die Idee, die Publikation mit einem Forum zu verknüpfen, sie also nicht nur durch Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern durch aktive Debatten. Die Publikation ist dabei ein Impulsgeber für Gespräche und auch andere Aktivitäten, die auch in diesem Forum zugänglich ist. Zum Glück konnten auch noch einige Veranstaltungen stattfinden, bevor die gegenwärtige Ausnahmesituation eintrat.
MW: Der Ausstellungsraum verknüpft die drei verschiedenen Aspekte: Die Publikation, die in einem großen Raum erst mal klein erscheint, ist das Kondensat des Forschungsprojektes. Mit dem Forum haben wir einen Ort erschaffen, an dem man die Publikation lesen, sich aber auch treffen und sprechen kann. Und die Ausstellung ist eine Form, wie mit dem Archivmaterial umgegangen werden kann, nämlich die Bearbeitung durch Künstler:innen. Diese Künstler:innen kommen von außen und schauen mit einem anderen Blick auf das Archiv als Forschende. Ein kommentierender und kritischer Blick verdichten sich in der Ausstellung The Public Matters. Was wir jetzt im Raum sehen, unterliegt einer Temporalität, während sich die Publikation auch noch in zehn Jahren aus dem Schrank nehmen lässt. Buch, Forum und Ausstellung sind also drei verschiedenen Varianten einer Debattenkultur.
Wie geht es mit dem Archiv weiter?
UF: Nun hoffen wir, dass wir einige der ausgefallenen Veranstaltungen, die geplant waren, bis zum Ende der Ausstellung Mitte November unter Sicherheitsauflagen noch durchführen können, denn es gibt noch ein paar Dinge, die auf der Agenda stehen. Geplant ist beispielsweise eine Summer School, die durch Covid-19 erst einmal ins Wanken geraten ist. Aber für ein oder zwei Tage wollen wir eine Videoschaltung mit internationalen Wissenschaftler:innen ermöglichen – um ein vorläufiges Resümé in Form einer Autumn School zu ziehen die wir etwas später veranstalten. Denn es gibt internationale Forscher:innen, die ihre Arbeiten auf Basis des Archivs hier in Münster verfasst haben. Ein Gespräch mit ihnen wäre sehr schön, um die Themenvielfalt, die sich aus dem Archiv entwickelt hat, nochmals in die Öffentlichkeit zu spiegeln und die Ergebnisse zur Diskussion stellen zu können und andererseits auch, um die Resultate der Forschung mit interessanten Fragestellungen noch einmal zusammenführen zu können. Vor allen Dingen aber, um die Forscher:innen auch untereinander ins Gespräch zu bringen. Vielleicht laden wir auch noch Künstler:innen ein, die sich bei dieser Abschlussveranstaltung des Projekts einbringen können. Außerdem ist noch eine Publikation zu der Ringvorlesung [Counter-]Monuments. Erinnerungspraxen im öffentlichen Raum/ Memory Practices in Public Space geplant. Dieser Sammelband mit Beiträgen von internationalen Autor:innen wird voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinen und einmal mehr die Funktionen des Archivs im Kontext einer Vielzahl aktueller Themen und Diskussionen beleuchten.
MW: Ein Projekt wie dieses schließt sich nicht einfach nach drei Jahren ab. Aufgenommen im Findbuch sind die Archivalien jetzt bis und mit 1997. Nun bräuchten wir eine Weiterführung der Prozesse, auch um Anfragen von Forschenden aus aller Welt nachkommen zu können. Die Aufnahme aller Archivalien bis heute sowie zusätzlicher Bestände ist noch ein sehr umfangreiches Unterfangen, denn mit dem Beginn des digitalen Zeitalters strukturieren sich die Konvolute auch anders und stellen andere Anforderungen. Der Wermutstropfen am Ende des dreijährigen Forschungsprojekts ist allerdings, dass die Archivstelle erst einmal nicht besetzt wurde. Jetzt gerade geht es darum, die Stelle zu verstetigen und das Archiv zu institutionalisieren damit das passiert, was wir mit der Publikation und der Ausstellung gemacht haben: die Öffentlichkeit mit dem Archiv ansprechen und das Archiv in die Öffentlichkeit bringen.